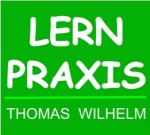Liebe Eltern, liebe selbst betroffene Erwachsene, herzlich willkommen auf dem Blog der Lernpraxis Thomas Wilhelm in Püttlingen, Nähe Völklingen, Saarbrücken und Saarlouis. Mein Angebot einer pädagogischen Lerntherapie wendet sich an all diejenigen, die Schwierigkeiten mit dem Schreiben, Lesen und/oder Rechnen haben; ihnen biete ich eine auf ihre individuellen Schwächen zugeschnittene Förderung an. Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne unter Tel. (0177) 3143183 zur Verfügung.
Lernpraxis Thomas Wilhelm - Hilfe bei Legasthenie und LRS im Saarland
Sonntag, 23. Dezember 2012
Verdacht auf LRS oder Dyskalkulie? Test- und Beratungstag in der Lernpraxis
Test- und Beratungstag (außerhalb der üblichen Öffnungszeiten) am Samstag, 02.02.13
Ihr Kind hat Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen?
Sie haben den Verdacht, es könne von LRS (Lese-Rechtschreibschwäche), Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen sein? Rufen Sie mich unter der Telefonnumer (0 68 98) 44 29 225 an und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
Am Test- und Beratungstag biete ich Ihnen auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten die Möglichkeit zu einem ersten kostenlosen LRS-/Dyskalkulie-Test und einem unverbindlichen Beratungsgespräch.
Die Tests und Beratungen finden am Samstag, 02.02.13, in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Lernpraxis Püttlingen, Bahnhofstr. 24, statt. Sollten Sie am Testtag keine Zeit haben, finden wir sicher einen für Sie (und Ihr Kind) passenderen Termin.
Um Störungen im Test oder im Training zu vermeiden, darf ich Sie bitten, an diesem Tag wie auch während der üblichen Öffnungszeiten Termine unbedingt vorher in einem Telefongespräch zu vereinbaren.
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Weitere Informationen zum LRS-Dyskalkulie-Test- und Beratungstag finden Sie hier.
Frohe Weihnachten und die Orthografie
Uns flattern alle Jahre wieder Weihnachstkarten ins Haus, in denen uns
„Fröhliche Weihnachten“ und ein „gutes Neues Jahr“ gewünscht wird.
Über die guten Wünsche freuen wir uns immer riesig. Die Rechtschreibfehler dagegen tun mir natürlich im Herzen weh. :-)
Aber weshalb schreibt man denn eigentlich „der Heilige Abend“, aber „ein gutes neues Jahr“?
Das liegt daran, dass der „Heilige Abend“ als Eigenname gilt und das dazugehörige Adjektiv großgeschrieben wird. Das „neue Jahr“ gilt nicht als Eigenname, deshalb wird das Adjektiv kleingeschrieben.
Gleiches gilt für „frohe Weihnachten“ oder „fröhliche Weihnachten“. Was Ihre Freude oder Fröhlichkeit jedoch keinesfalls schmälern sollte.
Machen Sie Ihren Lieben also eine doppelte Freude und äußern Sie orthografisch einwandfreie Wünsche! :-)
Wie dem auch sei:
Ich wünsche allen Schülern und Freunden der Lernpraxis frohe Weihnachten!
Thomas Wilhelm
PS: Auch "zwischen den Tagen" sind wir für Sie telefonisch zu erreichen.
Über die guten Wünsche freuen wir uns immer riesig. Die Rechtschreibfehler dagegen tun mir natürlich im Herzen weh. :-)
Aber weshalb schreibt man denn eigentlich „der Heilige Abend“, aber „ein gutes neues Jahr“?
Das liegt daran, dass der „Heilige Abend“ als Eigenname gilt und das dazugehörige Adjektiv großgeschrieben wird. Das „neue Jahr“ gilt nicht als Eigenname, deshalb wird das Adjektiv kleingeschrieben.
Gleiches gilt für „frohe Weihnachten“ oder „fröhliche Weihnachten“. Was Ihre Freude oder Fröhlichkeit jedoch keinesfalls schmälern sollte.
Machen Sie Ihren Lieben also eine doppelte Freude und äußern Sie orthografisch einwandfreie Wünsche! :-)
Wie dem auch sei:
Ich wünsche allen Schülern und Freunden der Lernpraxis frohe Weihnachten!
Thomas Wilhelm
PS: Auch "zwischen den Tagen" sind wir für Sie telefonisch zu erreichen.
Mittwoch, 12. Dezember 2012
Was erwartet mein Kind bei einem Legasthenie- oder LRS-Test?
Die psychologische Untersuchung durch einen Legasthenie-/LRS-Test hat
die Einordnung eines Lese- und/oder Rechtschreibproblems eines Kindes oder Jugendlichen in das ICD 10 (International Classification of
Diseases, Internationales Krankheitsklassifikationsschema) zum Ziel. Außerdem sollten sich aber aus diesem Test für den
Legasthenietrainer oder -therapeuten Rückschlüsse auf die Art des Trainings
und dessen Ansatzpunkte ergeben. Durch die medizinisch-psychologische
Testung und
Einordnung eines Lese-Rechtschreibproblems ergeben sich jedoch auch
im Gesetz festgelegte schulische und in einigen Fällen sogar finanzielle
Fördermöglichkeiten (nach § 35a, IIX SGB).
Zunächst einmal sollte vor einem Legasthenie-/LRS-Tests von den entsprechenden Fachärzten abgeklärt werden, ob ein Seh- oder Hörproblem vorliegt. Der Haus- oder Kinderarzt sollte Störungen des Stoffwechsels und einen Mangel an Mineralstoffen ausschließen. Diese Untersuchungen können ebenso wie eine Analyse der Gehirnströme (EEG) ausschließen, dass andere (medizinische) Ursachen für die Lernstörung vorliegen.
Welche Felder werden nun bei einem Legasthenie- oder LRS-Test abgeklärt?
Eingesetzt wird zunächst ein spezieller Intelligenztest für Kinder (z.B. HAWIK IV oder AID 2). Diese Testungen messen u.a. die Fähigkeit, logische Strukturen in Reihenfolgen (z.B. in Zahlenreihen oder Texten) zu erkennen, die Fähigkeit, zwei- oder dreidimensionale Flächen oder Räume in der geforderten Weise anzuordnen oder auch das stimmige Erfassen sozialer Zusammenhänge. Außerdem werden das visuelle und das auditive Erinnerungsvermögen, das Assoziieren von Begriffen sowie die Fähigkeit zum Verknüpfen von Begriffen überprüft. Diese und weitere Fähigkeiten werden bei diesen IQ-Tests als Maßstab für die intellektuelle Begabung des jungen Probanden herangezogen. Nur teilweise haben diese Tests etwas mit den Ansprüchen zu tun, die im schulischen Alltag üblicherweise gestellt werden.
Die IQ-Tests bestehen ihrerseits wieder aus Untertests. Dabei steigt innerhalb dieser Untertests jeweils von Aufgabe zu Aufgabe der Schwierigkeitsgrad. Diese Tests laufen in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen ab, d.h. das Kind hat für jede Aufgabe nur ein bestimmtes Zeitpensum zur Verfügung. Die dabei erreichten Punktzahlen werden in Beziehung zu einem Durchschnittswert gesetzt, der an einer hohen Zahl von gleichaltrigen Kindern ermittelt wurde. Diese Relation wiederum ergibt den maßgeblichen IQ des Kindes, der sich durch die einzelnen Gruppen von Tests wiederum in verschiedene Bereiche aufteilen lässt.
Kritisieren lässt sich an dieser Art der Intelligenzmessung, dass - gerade was teilleistungsgestörte Kinder angeht – ihre Aussagekraft angezweifelt werden darf. So werden in verschiedenen Untertests Aufgaben eingesetzt, die schriftsprachliche Fähigkeiten voraussetzen, die ja eben bei legasthenen oder lese-rechtschreibschwachen Kindern schwach ausgeprägt sind. In den betreffenden Untertests können die betroffenen Kinder logischerweise also nicht das Ergebnis erreichen, das eigentlich ihrem Intelligenzniveau entspräche.
Falls sich bei einem IQ-Test Anhaltspunkte für eine Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung) ergeben, sollte sich also konsequenterweise ein zweiter, sprachfreier Intelligenztest (z.B. CFT) anschließen. Diese Tests wiederum sind eigentlich nicht speziell als LRS- oder Legasthenietest für Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb, sondern als Test für Kinder mit Migrations- und damit unterschiedlichem muttersprachlichen Hintergrund konzipiert worden.
Wenn diese Tests jedoch nicht tatsächlich und sicher in der Lage sind, das Intelligenzniveau eines lese-rechtschreibschwachen Kindes zu messen, dann ist damit ist auch die Vorgabe der ICD-10 in Frage gestellt, dass Kinder, die unter einer intellektuellen Minderbegabung leiden, per Definition keine Legasthenie haben können.
Trotzdem kann die Ermittlung des Intelligenzniveaus im Rahmen eines Legasthenie-/LRS-Tests wertvolle Ergebnisse für eine zukünftige Förderung im Rahmen einer Therapie erbringen, da zumindest aufgezeigt werden kann, wo die individuellen Stärken des betroffenen Kindes liegen. Diese können dann in einer sich an den Test anschließenden Fördermaßnahme einbezogen werden.
Festzuhalten bleibt auch, dass solche Intelligenztests immer nur die Momentaufnahme der kognitiven Fähigkeiten eines Kindes sein können. Jedes Kind macht eine Entwicklung durch, die für die Ausbildung seiner intellektuellen Fähigkeiten anregend, aber auch stark hemmend ausfallen kann.
Lesen Sie den kompletten Artikel auf den Seiten der Lernpraxis Thomas Wilhelm:
Kleines Lexikon der Fachbegriffe, Legasthenie-/LRS-Test
Zunächst einmal sollte vor einem Legasthenie-/LRS-Tests von den entsprechenden Fachärzten abgeklärt werden, ob ein Seh- oder Hörproblem vorliegt. Der Haus- oder Kinderarzt sollte Störungen des Stoffwechsels und einen Mangel an Mineralstoffen ausschließen. Diese Untersuchungen können ebenso wie eine Analyse der Gehirnströme (EEG) ausschließen, dass andere (medizinische) Ursachen für die Lernstörung vorliegen.
Welche Felder werden nun bei einem Legasthenie- oder LRS-Test abgeklärt?
Eingesetzt wird zunächst ein spezieller Intelligenztest für Kinder (z.B. HAWIK IV oder AID 2). Diese Testungen messen u.a. die Fähigkeit, logische Strukturen in Reihenfolgen (z.B. in Zahlenreihen oder Texten) zu erkennen, die Fähigkeit, zwei- oder dreidimensionale Flächen oder Räume in der geforderten Weise anzuordnen oder auch das stimmige Erfassen sozialer Zusammenhänge. Außerdem werden das visuelle und das auditive Erinnerungsvermögen, das Assoziieren von Begriffen sowie die Fähigkeit zum Verknüpfen von Begriffen überprüft. Diese und weitere Fähigkeiten werden bei diesen IQ-Tests als Maßstab für die intellektuelle Begabung des jungen Probanden herangezogen. Nur teilweise haben diese Tests etwas mit den Ansprüchen zu tun, die im schulischen Alltag üblicherweise gestellt werden.
Die IQ-Tests bestehen ihrerseits wieder aus Untertests. Dabei steigt innerhalb dieser Untertests jeweils von Aufgabe zu Aufgabe der Schwierigkeitsgrad. Diese Tests laufen in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen ab, d.h. das Kind hat für jede Aufgabe nur ein bestimmtes Zeitpensum zur Verfügung. Die dabei erreichten Punktzahlen werden in Beziehung zu einem Durchschnittswert gesetzt, der an einer hohen Zahl von gleichaltrigen Kindern ermittelt wurde. Diese Relation wiederum ergibt den maßgeblichen IQ des Kindes, der sich durch die einzelnen Gruppen von Tests wiederum in verschiedene Bereiche aufteilen lässt.
Kritisieren lässt sich an dieser Art der Intelligenzmessung, dass - gerade was teilleistungsgestörte Kinder angeht – ihre Aussagekraft angezweifelt werden darf. So werden in verschiedenen Untertests Aufgaben eingesetzt, die schriftsprachliche Fähigkeiten voraussetzen, die ja eben bei legasthenen oder lese-rechtschreibschwachen Kindern schwach ausgeprägt sind. In den betreffenden Untertests können die betroffenen Kinder logischerweise also nicht das Ergebnis erreichen, das eigentlich ihrem Intelligenzniveau entspräche.
Falls sich bei einem IQ-Test Anhaltspunkte für eine Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung) ergeben, sollte sich also konsequenterweise ein zweiter, sprachfreier Intelligenztest (z.B. CFT) anschließen. Diese Tests wiederum sind eigentlich nicht speziell als LRS- oder Legasthenietest für Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb, sondern als Test für Kinder mit Migrations- und damit unterschiedlichem muttersprachlichen Hintergrund konzipiert worden.
Wenn diese Tests jedoch nicht tatsächlich und sicher in der Lage sind, das Intelligenzniveau eines lese-rechtschreibschwachen Kindes zu messen, dann ist damit ist auch die Vorgabe der ICD-10 in Frage gestellt, dass Kinder, die unter einer intellektuellen Minderbegabung leiden, per Definition keine Legasthenie haben können.
Trotzdem kann die Ermittlung des Intelligenzniveaus im Rahmen eines Legasthenie-/LRS-Tests wertvolle Ergebnisse für eine zukünftige Förderung im Rahmen einer Therapie erbringen, da zumindest aufgezeigt werden kann, wo die individuellen Stärken des betroffenen Kindes liegen. Diese können dann in einer sich an den Test anschließenden Fördermaßnahme einbezogen werden.
Festzuhalten bleibt auch, dass solche Intelligenztests immer nur die Momentaufnahme der kognitiven Fähigkeiten eines Kindes sein können. Jedes Kind macht eine Entwicklung durch, die für die Ausbildung seiner intellektuellen Fähigkeiten anregend, aber auch stark hemmend ausfallen kann.
Lesen Sie den kompletten Artikel auf den Seiten der Lernpraxis Thomas Wilhelm:
Kleines Lexikon der Fachbegriffe, Legasthenie-/LRS-Test
Montag, 10. Dezember 2012
Auch Kinder und Jugendliche leiden unter Depressionen
Inzwischen gehören Depressionen mit zu den am
häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Jeder fünfte Deutsche hat schon mindestens einmal unter einer Depression gelitten,
die Anzahl der Depressions-Diagnosen wächst ständig. Angemerkt muss auch werden, dass etwa die
Hälfte der Erkrankungen nicht erkannt und dementsprechend
nicht behandelt wird. Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen, ebenfalls mit in den vergangenen Jahren
steigenden Zahlen.
Eine fachgerechte Diagnose im Kinder- und Jugendalter ist schwierig. Die Symptomatiken bei Kindern und Jugendlichen sind nicht eindeutig, sie weichen häufig erheblich von dem Krankheitsbild bei Erwachsenen ab. Die Diagnose wird zudem dadurch erschwert, dass vor allem Klein- und Vorschulkinder ihren psychischen Zustand nur sehr eingschränkt beschreiben können. Insbesondere bei Kindern jedoch ist eine Depression oft langwierig und auch die Rückfallquote hoch.
Wichtig: Wie bei Erwachsenen sind depressive Störungen auch bei Kindern und Jugendlichen ein sehr ernstzunehmendes Krankheitsbild (Selbstverletzungs- und sogar Suizidgefahr!), das bei Auffälligkeiten einen Gang zum Kinderarzt – oder noch besser zum Kinder- und Jugendpsychiater – unbedingt erforderlich macht.
Weiterlesen auf der Seite der Lernpraxis Thomas Wilhelm ...
Eine fachgerechte Diagnose im Kinder- und Jugendalter ist schwierig. Die Symptomatiken bei Kindern und Jugendlichen sind nicht eindeutig, sie weichen häufig erheblich von dem Krankheitsbild bei Erwachsenen ab. Die Diagnose wird zudem dadurch erschwert, dass vor allem Klein- und Vorschulkinder ihren psychischen Zustand nur sehr eingschränkt beschreiben können. Insbesondere bei Kindern jedoch ist eine Depression oft langwierig und auch die Rückfallquote hoch.
Wichtig: Wie bei Erwachsenen sind depressive Störungen auch bei Kindern und Jugendlichen ein sehr ernstzunehmendes Krankheitsbild (Selbstverletzungs- und sogar Suizidgefahr!), das bei Auffälligkeiten einen Gang zum Kinderarzt – oder noch besser zum Kinder- und Jugendpsychiater – unbedingt erforderlich macht.
Weiterlesen auf der Seite der Lernpraxis Thomas Wilhelm ...
Dienstag, 4. Dezember 2012
Marburger Konzentrationstraining auch bei LRS und Legasthenie
Püttlingen/Saarland: Konzentrationstraining. - Dass von ADS oder ADHS
betroffene Kinder Probleme haben, sich zu konzentrieren, ist hinlänglich bekannt. Unsere Welt ist
heute aber voll von
Ablenkungen wie Handy, TV, Computerspielen usw., der oftmals durch die
Schule entstehende Leistungsdruck tut ein Übriges. So fällt es immer mehr Schülern schwer, ihre
Konzentration
auf derjenigen Aufgabe zu halten, die es jetzt gerade zu lösen gilt, ihre
Aufmerksamkeit auf sie zu fokussieren und strukturiert zu arbeiten.
Das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm eingesetzte Marburger Konzentrationstraining (MKT) wurde von dem Lehrer und Schulpsychologen Dieter Krowatschek als Kurzintervention entwickelt und am Psychologischen Institut der Marburger Universität getestet und ausgearbeitet.
Ein Konzentrationstraininig nach dem Marburger Modell kann unterstützend bei Schulkindern und Jugendlichen wirken, die einen sprunghaften Lern- und Arbeitsstil haben und dadurch in ihrem Lernfortschritt beeinträchtigt sind, die oft trödeln, sich ablenken lassen oder vor sich hin träumen (was ja prinzipiell nichts Verwerfliches ist, im Übermaß aber zwischenKind und Eltern oft zu Spannungen führt). Hilfreich kann es auch bei Kindern sein, die ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, was ihre Leistungen betrifft. Da sich bei vielen von einer LRS oder Legasthenie betroffenen Schülern die genannten Symptome wiederfinden, fließen Elemente des Marburger Konzentrationstrainings oftmals auch in meine Arbeit mit diesen Kindern ein.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte weiter auf der Seite der Lernpraxis Thomas Wilhelm: www.lernpraxis-deutsch.de
Das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm eingesetzte Marburger Konzentrationstraining (MKT) wurde von dem Lehrer und Schulpsychologen Dieter Krowatschek als Kurzintervention entwickelt und am Psychologischen Institut der Marburger Universität getestet und ausgearbeitet.
Ein Konzentrationstraininig nach dem Marburger Modell kann unterstützend bei Schulkindern und Jugendlichen wirken, die einen sprunghaften Lern- und Arbeitsstil haben und dadurch in ihrem Lernfortschritt beeinträchtigt sind, die oft trödeln, sich ablenken lassen oder vor sich hin träumen (was ja prinzipiell nichts Verwerfliches ist, im Übermaß aber zwischenKind und Eltern oft zu Spannungen führt). Hilfreich kann es auch bei Kindern sein, die ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, was ihre Leistungen betrifft. Da sich bei vielen von einer LRS oder Legasthenie betroffenen Schülern die genannten Symptome wiederfinden, fließen Elemente des Marburger Konzentrationstrainings oftmals auch in meine Arbeit mit diesen Kindern ein.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte weiter auf der Seite der Lernpraxis Thomas Wilhelm: www.lernpraxis-deutsch.de
Freitag, 23. November 2012
Schriftspracherwerb
Das Lesen und Schreiben gehören heute in unserer Kultur zu den
grundlegenden Fertigkeiten, die einem Menschen die uneingeschränkte
Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Kinder beginnen mit
dem Entdecken der Schriftsprache bereits weit vor dem
Grundschuleintritt. Dabei sind die Kinder im Vorteil, die viel Kontakt
zu Büchern haben, denen zu Hause regelmäßig vorgelesen wird und denen
die
Eltern Vorbild im Lesen von Bücher oder Zeitungen sind.
Der Schriftspracherwerb (nach GÜNTHER) lässt sich vor und während der Grundschulzeit in folgende Stufen gliedern:
Zunächst ahmt das Kind in der Kritzelstufe (auch präliteral-symbolische Stufe) das Schreiben von Buchstaben und Wörtern nach. Es „spielt“ Lesen und Schreiben, hält dabei das Buch schon mal verkehrt herum und „schreibt“ Zeichen, deren Sinngehalt sich nur ihm allein erschließen. Ohne auch nur einen Buchstaben zu kennen ahnt es bereits, dass lesen und schreiben etwas mit der Wiedergabe von Erzähltem zu tun haben.
In der logographischen Stufe (auch logographemische Stufe) ist dann den Kindern bereits klar, dass die oft auftauchenden Zeichen (Buchstaben) in Verbindung zu Dingen oder Erzählungen stehen. Es kann schon ganze Schriftzüge erkennen (so z.B. das Logo von „Coca-Cola“). Das Kind kann dabei noch nicht lesen, es hat vielmehr die wiedererkannten Zeichen als Bilder im Gehirn gespeichert und wieder abgerufen.
Die alphabetische Stufe erlaubt es Kindern dann als erste schulische Stufe des Schriftspracherwerbs, die Buchstaben (Grapheme) mit Lauten (Phoneme) in Verbindung zu setzen. Das Wort DOSE z.B. wird in seine einzelnen Buchstaben zerlegt (Analyse) und das Kind dabei angeleitet, die Buchstaben D-O-S-E zu hören. Umgekehrt verhält es sich mit dem Verbinden (Synthese) der Buchstaben zu einem Wort. Diese Stufe ist oft von einer lautgetreuen Schreibweise der auch im Deutschen nicht immer lautgetreuen Sprache geprägt. Das Kind hört z.B. am Wortende von „Hand“ ein t und verschriftlicht dieses Wort – logischerweise -als „Hant“. Kinder haben in der alphabetischen Stufe jedoch meist viel Spaß am Schreiben, da es Neues zu entdecken und diese Entdeckungen auch umzusetzen gilt. Vor allem diese alphabetische Stufe steht in einem engen Zusammenhang zur phonologischen Bewusstheit eines Kindes.
In der orthographischen Stufe steht das Erlernen von Rechtschreibregeln im Vordergrund (Mitlautverdopplung, s-Laute, k-laute etc.). Ebenso können Kinder in der Regel jetzt beim Lesen nicht mehr nur die einzelnen Buchstaben, sondern bereits Buchstabenverbindungen erfassen und dementsprechend schneller sinnverstehend lesen. Der häufige Umgang mit Büchern ist für das Fortschreiten in dieser Stufe besonders wichtig.
Die grammatikalische Stufe erlaubt den Kindern Einsicht in die Satzstruktur, in den Aufbau von Wörtern in Vor- und Endsilben sowie Wortstämme (Morpheme), in Wortbildung, Groß- und Klein-, Getrennt- und Zusammenschreibung und in die Zeichensetzung. Diese Stufe dehnt sich bis in die höheren Klassen aus und stellt auch Erwachsene immer wieder vor Herausforderungen.
Als abschließende Stufe des Schriftspracherwerbs folgt dann die integriert-automatisierte Stufe. Durch häufiges Lesen und Schreiben werden die erworbenen Regeln „eingeschliffen“. Wörter werden als Ganzes gelesen und beim Schreiben muss sich das Kind nicht mehr bei jedem Wort die gelernten Rechtschreibregeln ins Gedächtnis rufen. Dieses automatisierte und schnellere Lesen und Schreiben erlaubt es ihm, seine Konzentration auf das Textverstehen und Aufgabenstellungen zu lenken, die „Arbeitsgeschwindigkeit“ erhöht sich.
Weitere Informationen zu den Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs erhalten Sie auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Probleme beim Schriftspracherwerb können in allen genannten Stufen auftauchen. Deshalb ist es wichtig, das Kind bei Auffälligkeiten auch schon im letzten Vorschuljahr untersuchen und gegebenenfalls fördern zu lassen. Die im Zusammenhang mit der alphabetischen Stufe bereits genannte phonologische Bewusstheit (im weiteren Sinne) ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen und problemfreien Erwerb der Schriftsprache. Je früher eine Förderung einsetzt, umso erfolgversprechender kann einer LRS oder der Ausprägung einer Legasthenie entgegengewirkt werden.
Auch beim Auftauchen von Schwierigkeiten in den darauf folgenden Stufen sollte eine zusätzliche Förderung, ob im schulischen oder außerschulischen Bereich, immer erwogen werden. Damit kann dem Kind eine „Karriere“ als lese-rechtschreibschwacher Schüler erspart bleiben und ihm seine schulische Laufbahn erheblich erleichtert werden.
Der Schriftspracherwerb (nach GÜNTHER) lässt sich vor und während der Grundschulzeit in folgende Stufen gliedern:
Zunächst ahmt das Kind in der Kritzelstufe (auch präliteral-symbolische Stufe) das Schreiben von Buchstaben und Wörtern nach. Es „spielt“ Lesen und Schreiben, hält dabei das Buch schon mal verkehrt herum und „schreibt“ Zeichen, deren Sinngehalt sich nur ihm allein erschließen. Ohne auch nur einen Buchstaben zu kennen ahnt es bereits, dass lesen und schreiben etwas mit der Wiedergabe von Erzähltem zu tun haben.
In der logographischen Stufe (auch logographemische Stufe) ist dann den Kindern bereits klar, dass die oft auftauchenden Zeichen (Buchstaben) in Verbindung zu Dingen oder Erzählungen stehen. Es kann schon ganze Schriftzüge erkennen (so z.B. das Logo von „Coca-Cola“). Das Kind kann dabei noch nicht lesen, es hat vielmehr die wiedererkannten Zeichen als Bilder im Gehirn gespeichert und wieder abgerufen.
Die alphabetische Stufe erlaubt es Kindern dann als erste schulische Stufe des Schriftspracherwerbs, die Buchstaben (Grapheme) mit Lauten (Phoneme) in Verbindung zu setzen. Das Wort DOSE z.B. wird in seine einzelnen Buchstaben zerlegt (Analyse) und das Kind dabei angeleitet, die Buchstaben D-O-S-E zu hören. Umgekehrt verhält es sich mit dem Verbinden (Synthese) der Buchstaben zu einem Wort. Diese Stufe ist oft von einer lautgetreuen Schreibweise der auch im Deutschen nicht immer lautgetreuen Sprache geprägt. Das Kind hört z.B. am Wortende von „Hand“ ein t und verschriftlicht dieses Wort – logischerweise -als „Hant“. Kinder haben in der alphabetischen Stufe jedoch meist viel Spaß am Schreiben, da es Neues zu entdecken und diese Entdeckungen auch umzusetzen gilt. Vor allem diese alphabetische Stufe steht in einem engen Zusammenhang zur phonologischen Bewusstheit eines Kindes.
In der orthographischen Stufe steht das Erlernen von Rechtschreibregeln im Vordergrund (Mitlautverdopplung, s-Laute, k-laute etc.). Ebenso können Kinder in der Regel jetzt beim Lesen nicht mehr nur die einzelnen Buchstaben, sondern bereits Buchstabenverbindungen erfassen und dementsprechend schneller sinnverstehend lesen. Der häufige Umgang mit Büchern ist für das Fortschreiten in dieser Stufe besonders wichtig.
Die grammatikalische Stufe erlaubt den Kindern Einsicht in die Satzstruktur, in den Aufbau von Wörtern in Vor- und Endsilben sowie Wortstämme (Morpheme), in Wortbildung, Groß- und Klein-, Getrennt- und Zusammenschreibung und in die Zeichensetzung. Diese Stufe dehnt sich bis in die höheren Klassen aus und stellt auch Erwachsene immer wieder vor Herausforderungen.
Als abschließende Stufe des Schriftspracherwerbs folgt dann die integriert-automatisierte Stufe. Durch häufiges Lesen und Schreiben werden die erworbenen Regeln „eingeschliffen“. Wörter werden als Ganzes gelesen und beim Schreiben muss sich das Kind nicht mehr bei jedem Wort die gelernten Rechtschreibregeln ins Gedächtnis rufen. Dieses automatisierte und schnellere Lesen und Schreiben erlaubt es ihm, seine Konzentration auf das Textverstehen und Aufgabenstellungen zu lenken, die „Arbeitsgeschwindigkeit“ erhöht sich.
Weitere Informationen zu den Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs erhalten Sie auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Probleme beim Schriftspracherwerb können in allen genannten Stufen auftauchen. Deshalb ist es wichtig, das Kind bei Auffälligkeiten auch schon im letzten Vorschuljahr untersuchen und gegebenenfalls fördern zu lassen. Die im Zusammenhang mit der alphabetischen Stufe bereits genannte phonologische Bewusstheit (im weiteren Sinne) ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen und problemfreien Erwerb der Schriftsprache. Je früher eine Förderung einsetzt, umso erfolgversprechender kann einer LRS oder der Ausprägung einer Legasthenie entgegengewirkt werden.
Auch beim Auftauchen von Schwierigkeiten in den darauf folgenden Stufen sollte eine zusätzliche Förderung, ob im schulischen oder außerschulischen Bereich, immer erwogen werden. Damit kann dem Kind eine „Karriere“ als lese-rechtschreibschwacher Schüler erspart bleiben und ihm seine schulische Laufbahn erheblich erleichtert werden.
Dienstag, 20. November 2012
Phonologische Bewusstheit
Phonologische Bewusstheit
Kleines Lexikon der Fachbegriffe
Als phonologische Bewusstheit
bezeichnet man die Fähigkeit, die Struktur der Lautsprache zu erkennen
und Sprachelemente bewusst zu gebrauchen. Dieses Bewusstsein ist nicht
angeboren, sondern wird vom Kind in der Regel selbstständig erlernt und
eingeübt. Unterschieden wird dabei zwischen phonologischer Bewusstheit
im weiteren und im engeren Sinn.
Das Erkennen von Reimen zum Beispiel oder das Zerlegen von Wörtern in Silben sind Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Diese Fähigkeit wird als eine grundlegende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb angesehen, die die meisten Schulanfänger bereits in einem hohen Maß besitzen. Diese Fähigkeiten orientieren sich eher an der Oberflächenstruktur der Sprache.
Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist auf die einzelnen Laute gerichtet und bezieht sich auf Aufgaben wie etwa das Erkennen von An- und Auslauten oder auch das Synthetisieren von Lauten. Beispiele dafür sind Fragen wie: Wo hörst du das n in Nase? Ganz vorne, in der Mitte oder am Schluss? Wie heißt das Wort Omi, wenn du das i gegen ein a austauschst? Welches Wort bleibt, wenn du bei rund das r weglässt weglässt?
Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die sprachliche Entwicklung ist durch viele Studien belegt, die den Zusammenhang zwischen ihr und den späteren Leistungen im Lesen und Schreiben belegen. Für das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm zum Training des phonologischen Bewusstsein überwiegend eingesetzte Würzburger Trainingsprogramm "Hören, lauschen, lernen" von Petra Küspert und Prof. Wolfgang Schneider liegt u.a. ein Bericht der Universität des Saarlandes vor. All diese Untersuchungen zeigen, dass eine Überprüfung und eventuelle Förderung dieser Fähigkeiten im Kindergartenalter die Kompetenzen beim Lesen und Rechtschreiben bis weit in die Schulzeit vorhersagen kann.
Kinder mit gering entwickelten phonematischen Fähigkeiten sind meist ohne zusätzliche Förderung nicht in der Lage, sprachlichen Lauten die entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. Lese- und Rechtschreibprobleme, die durch das ungenügende Aneignen einer phonologischen Bewusstheit entstanden sind, können später nur mit erheblichem Aufwand behoben werden.
Durch ein Training der phonologischen Bewusstheit, wie es auch in der Lernpraxis Thomas Wilhelm durchgeführt wird, wird das Kind schon ab dem letzten Vorschuljahr langsam und spielerisch an die Bewusstheit für Wörter, Silben und Laute herangeführt. Es werden Lausch-, Reim-, Silben- und Lautspiele durchgeführt und Freude am Zuhören und dem Umgang mit Sprache vermittelt.
Das Kind wird zudem dabei in seinen Fähigkeiten unterstützt ausdauernd zuzuhören, sich zu konzentrieren und still zu sitzen. Es lernt spielerisch sich auf eine Aufgaben zu konzentrieren und sich nicht von der Umgebung ablenken zu lassen.
Auch bei Kindern, die bereits die Schule besuchen und Lese- bzw. Rechtschreibprobleme haben (siehe die entprechenden Einträge für Legasthenie und LRS), ist dieses Training neben dem Einüben von speziellen Lese- und Rechtschreibstrategien in einer dem Alter angepassten Form häufig ratsam. Die Probleme resultieren in vielen Fällen daraus, dass phonologische Fähigkeiten im Vorschulalter nicht oder nur ungenügend erlernt wurden. Selbst bei Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, kann diese basale Fähigkeit nach einer Überprüfung noch trainiert werden.
Das Erkennen von Reimen zum Beispiel oder das Zerlegen von Wörtern in Silben sind Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Diese Fähigkeit wird als eine grundlegende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb angesehen, die die meisten Schulanfänger bereits in einem hohen Maß besitzen. Diese Fähigkeiten orientieren sich eher an der Oberflächenstruktur der Sprache.
Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist auf die einzelnen Laute gerichtet und bezieht sich auf Aufgaben wie etwa das Erkennen von An- und Auslauten oder auch das Synthetisieren von Lauten. Beispiele dafür sind Fragen wie: Wo hörst du das n in Nase? Ganz vorne, in der Mitte oder am Schluss? Wie heißt das Wort Omi, wenn du das i gegen ein a austauschst? Welches Wort bleibt, wenn du bei rund das r weglässt weglässt?
Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die sprachliche Entwicklung ist durch viele Studien belegt, die den Zusammenhang zwischen ihr und den späteren Leistungen im Lesen und Schreiben belegen. Für das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm zum Training des phonologischen Bewusstsein überwiegend eingesetzte Würzburger Trainingsprogramm "Hören, lauschen, lernen" von Petra Küspert und Prof. Wolfgang Schneider liegt u.a. ein Bericht der Universität des Saarlandes vor. All diese Untersuchungen zeigen, dass eine Überprüfung und eventuelle Förderung dieser Fähigkeiten im Kindergartenalter die Kompetenzen beim Lesen und Rechtschreiben bis weit in die Schulzeit vorhersagen kann.
Kinder mit gering entwickelten phonematischen Fähigkeiten sind meist ohne zusätzliche Förderung nicht in der Lage, sprachlichen Lauten die entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. Lese- und Rechtschreibprobleme, die durch das ungenügende Aneignen einer phonologischen Bewusstheit entstanden sind, können später nur mit erheblichem Aufwand behoben werden.
Durch ein Training der phonologischen Bewusstheit, wie es auch in der Lernpraxis Thomas Wilhelm durchgeführt wird, wird das Kind schon ab dem letzten Vorschuljahr langsam und spielerisch an die Bewusstheit für Wörter, Silben und Laute herangeführt. Es werden Lausch-, Reim-, Silben- und Lautspiele durchgeführt und Freude am Zuhören und dem Umgang mit Sprache vermittelt.
Das Kind wird zudem dabei in seinen Fähigkeiten unterstützt ausdauernd zuzuhören, sich zu konzentrieren und still zu sitzen. Es lernt spielerisch sich auf eine Aufgaben zu konzentrieren und sich nicht von der Umgebung ablenken zu lassen.
Auch bei Kindern, die bereits die Schule besuchen und Lese- bzw. Rechtschreibprobleme haben (siehe die entprechenden Einträge für Legasthenie und LRS), ist dieses Training neben dem Einüben von speziellen Lese- und Rechtschreibstrategien in einer dem Alter angepassten Form häufig ratsam. Die Probleme resultieren in vielen Fällen daraus, dass phonologische Fähigkeiten im Vorschulalter nicht oder nur ungenügend erlernt wurden. Selbst bei Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, kann diese basale Fähigkeit nach einer Überprüfung noch trainiert werden.
Abonnieren
Posts (Atom)