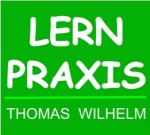Das Lesen und Schreiben gehören heute in unserer Kultur zu den
grundlegenden Fertigkeiten, die einem Menschen die uneingeschränkte
Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Kinder beginnen mit
dem Entdecken der Schriftsprache bereits weit vor dem
Grundschuleintritt. Dabei sind die Kinder im Vorteil, die viel Kontakt
zu Büchern haben, denen zu Hause regelmäßig vorgelesen wird und denen
die
Eltern Vorbild im Lesen von Bücher oder Zeitungen sind.
Der Schriftspracherwerb (nach GÜNTHER) lässt sich vor und während der Grundschulzeit in folgende Stufen gliedern:
Zunächst ahmt das Kind in der Kritzelstufe (auch
präliteral-symbolische Stufe) das Schreiben von Buchstaben und Wörtern
nach. Es „spielt“ Lesen und Schreiben, hält dabei das Buch
schon mal verkehrt herum und „schreibt“ Zeichen, deren Sinngehalt sich
nur ihm allein erschließen. Ohne auch nur einen Buchstaben zu kennen
ahnt es bereits, dass lesen und schreiben etwas mit der
Wiedergabe von Erzähltem zu tun haben.
In der logographischen Stufe (auch logographemische
Stufe) ist dann den Kindern bereits klar, dass die oft auftauchenden
Zeichen (Buchstaben) in Verbindung zu Dingen oder
Erzählungen stehen. Es kann schon ganze Schriftzüge erkennen (so z.B.
das Logo von „Coca-Cola“). Das Kind kann dabei noch nicht lesen, es hat
vielmehr die wiedererkannten Zeichen als Bilder im Gehirn
gespeichert und wieder abgerufen.
Die alphabetische Stufe erlaubt es Kindern dann als
erste schulische Stufe des Schriftspracherwerbs, die Buchstaben
(Grapheme) mit Lauten (Phoneme) in Verbindung zu setzen. Das
Wort DOSE z.B. wird in seine einzelnen Buchstaben zerlegt (Analyse) und
das Kind dabei angeleitet, die Buchstaben D-O-S-E zu hören. Umgekehrt
verhält es sich mit dem Verbinden (Synthese) der
Buchstaben zu einem Wort. Diese Stufe ist oft von einer lautgetreuen
Schreibweise der auch im Deutschen nicht immer lautgetreuen Sprache
geprägt. Das Kind hört z.B. am Wortende von „Hand“ ein t und
verschriftlicht dieses Wort – logischerweise -als „Hant“. Kinder haben
in der alphabetischen Stufe jedoch meist viel Spaß am Schreiben, da es
Neues zu entdecken und diese Entdeckungen auch umzusetzen
gilt. Vor allem diese alphabetische Stufe steht in einem engen
Zusammenhang zur phonologischen Bewusstheit eines Kindes.
In der orthographischen Stufe steht das Erlernen von
Rechtschreibregeln im Vordergrund (Mitlautverdopplung, s-Laute, k-laute
etc.). Ebenso können Kinder in der Regel jetzt beim
Lesen nicht mehr nur die einzelnen Buchstaben, sondern bereits
Buchstabenverbindungen erfassen und dementsprechend schneller
sinnverstehend lesen. Der häufige Umgang mit Büchern ist für das
Fortschreiten in dieser Stufe besonders wichtig.
Die grammatikalische Stufe erlaubt den Kindern
Einsicht in die Satzstruktur, in den Aufbau von Wörtern in Vor- und
Endsilben sowie Wortstämme (Morpheme), in Wortbildung, Groß- und
Klein-, Getrennt- und Zusammenschreibung und in die Zeichensetzung.
Diese Stufe dehnt sich bis in die höheren Klassen aus und stellt auch
Erwachsene immer wieder vor Herausforderungen.
Als abschließende Stufe des Schriftspracherwerbs folgt dann die integriert-automatisierte Stufe.
Durch häufiges Lesen und Schreiben werden die erworbenen Regeln
„eingeschliffen“.
Wörter werden als Ganzes gelesen und beim Schreiben muss sich das Kind
nicht mehr bei jedem Wort die gelernten Rechtschreibregeln ins
Gedächtnis rufen. Dieses automatisierte und schnellere Lesen und
Schreiben erlaubt es ihm, seine Konzentration auf das Textverstehen und Aufgabenstellungen zu lenken, die „Arbeitsgeschwindigkeit“ erhöht sich.
Weitere Informationen zu den Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs erhalten Sie auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Probleme beim Schriftspracherwerb können in allen
genannten Stufen auftauchen. Deshalb ist es wichtig, das Kind bei
Auffälligkeiten auch schon im letzten Vorschuljahr untersuchen
und gegebenenfalls fördern zu lassen. Die im Zusammenhang mit der
alphabetischen Stufe bereits genannte phonologische Bewusstheit
(im weiteren Sinne) ist eine
Grundvoraussetzung für den erfolgreichen und problemfreien Erwerb der
Schriftsprache. Je früher eine Förderung einsetzt, umso
erfolgversprechender kann einer LRS
oder der Ausprägung einer Legasthenie entgegengewirkt werden.
Auch beim Auftauchen von Schwierigkeiten in den darauf folgenden Stufen sollte eine zusätzliche Förderung,
ob im schulischen oder außerschulischen Bereich,
immer erwogen werden. Damit kann dem Kind eine „Karriere“ als
lese-rechtschreibschwacher Schüler erspart bleiben und ihm seine
schulische Laufbahn erheblich erleichtert werden.
Liebe Eltern, liebe selbst betroffene Erwachsene, herzlich willkommen auf dem Blog der Lernpraxis Thomas Wilhelm in Püttlingen, Nähe Völklingen, Saarbrücken und Saarlouis. Mein Angebot einer pädagogischen Lerntherapie wendet sich an all diejenigen, die Schwierigkeiten mit dem Schreiben, Lesen und/oder Rechnen haben; ihnen biete ich eine auf ihre individuellen Schwächen zugeschnittene Förderung an. Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne unter Tel. (0177) 3143183 zur Verfügung.
Lernpraxis Thomas Wilhelm - Hilfe bei Legasthenie und LRS im Saarland
Freitag, 23. November 2012
Dienstag, 20. November 2012
Phonologische Bewusstheit
Phonologische Bewusstheit
Kleines Lexikon der Fachbegriffe
Als phonologische Bewusstheit
bezeichnet man die Fähigkeit, die Struktur der Lautsprache zu erkennen
und Sprachelemente bewusst zu gebrauchen. Dieses Bewusstsein ist nicht
angeboren, sondern wird vom Kind in der Regel selbstständig erlernt und
eingeübt. Unterschieden wird dabei zwischen phonologischer Bewusstheit
im weiteren und im engeren Sinn.
Das Erkennen von Reimen zum Beispiel oder das Zerlegen von Wörtern in Silben sind Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Diese Fähigkeit wird als eine grundlegende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb angesehen, die die meisten Schulanfänger bereits in einem hohen Maß besitzen. Diese Fähigkeiten orientieren sich eher an der Oberflächenstruktur der Sprache.
Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist auf die einzelnen Laute gerichtet und bezieht sich auf Aufgaben wie etwa das Erkennen von An- und Auslauten oder auch das Synthetisieren von Lauten. Beispiele dafür sind Fragen wie: Wo hörst du das n in Nase? Ganz vorne, in der Mitte oder am Schluss? Wie heißt das Wort Omi, wenn du das i gegen ein a austauschst? Welches Wort bleibt, wenn du bei rund das r weglässt weglässt?
Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die sprachliche Entwicklung ist durch viele Studien belegt, die den Zusammenhang zwischen ihr und den späteren Leistungen im Lesen und Schreiben belegen. Für das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm zum Training des phonologischen Bewusstsein überwiegend eingesetzte Würzburger Trainingsprogramm "Hören, lauschen, lernen" von Petra Küspert und Prof. Wolfgang Schneider liegt u.a. ein Bericht der Universität des Saarlandes vor. All diese Untersuchungen zeigen, dass eine Überprüfung und eventuelle Förderung dieser Fähigkeiten im Kindergartenalter die Kompetenzen beim Lesen und Rechtschreiben bis weit in die Schulzeit vorhersagen kann.
Kinder mit gering entwickelten phonematischen Fähigkeiten sind meist ohne zusätzliche Förderung nicht in der Lage, sprachlichen Lauten die entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. Lese- und Rechtschreibprobleme, die durch das ungenügende Aneignen einer phonologischen Bewusstheit entstanden sind, können später nur mit erheblichem Aufwand behoben werden.
Durch ein Training der phonologischen Bewusstheit, wie es auch in der Lernpraxis Thomas Wilhelm durchgeführt wird, wird das Kind schon ab dem letzten Vorschuljahr langsam und spielerisch an die Bewusstheit für Wörter, Silben und Laute herangeführt. Es werden Lausch-, Reim-, Silben- und Lautspiele durchgeführt und Freude am Zuhören und dem Umgang mit Sprache vermittelt.
Das Kind wird zudem dabei in seinen Fähigkeiten unterstützt ausdauernd zuzuhören, sich zu konzentrieren und still zu sitzen. Es lernt spielerisch sich auf eine Aufgaben zu konzentrieren und sich nicht von der Umgebung ablenken zu lassen.
Auch bei Kindern, die bereits die Schule besuchen und Lese- bzw. Rechtschreibprobleme haben (siehe die entprechenden Einträge für Legasthenie und LRS), ist dieses Training neben dem Einüben von speziellen Lese- und Rechtschreibstrategien in einer dem Alter angepassten Form häufig ratsam. Die Probleme resultieren in vielen Fällen daraus, dass phonologische Fähigkeiten im Vorschulalter nicht oder nur ungenügend erlernt wurden. Selbst bei Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, kann diese basale Fähigkeit nach einer Überprüfung noch trainiert werden.
Das Erkennen von Reimen zum Beispiel oder das Zerlegen von Wörtern in Silben sind Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Diese Fähigkeit wird als eine grundlegende Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb angesehen, die die meisten Schulanfänger bereits in einem hohen Maß besitzen. Diese Fähigkeiten orientieren sich eher an der Oberflächenstruktur der Sprache.
Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn ist auf die einzelnen Laute gerichtet und bezieht sich auf Aufgaben wie etwa das Erkennen von An- und Auslauten oder auch das Synthetisieren von Lauten. Beispiele dafür sind Fragen wie: Wo hörst du das n in Nase? Ganz vorne, in der Mitte oder am Schluss? Wie heißt das Wort Omi, wenn du das i gegen ein a austauschst? Welches Wort bleibt, wenn du bei rund das r weglässt weglässt?
Die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für die sprachliche Entwicklung ist durch viele Studien belegt, die den Zusammenhang zwischen ihr und den späteren Leistungen im Lesen und Schreiben belegen. Für das in der Lernpraxis Thomas Wilhelm zum Training des phonologischen Bewusstsein überwiegend eingesetzte Würzburger Trainingsprogramm "Hören, lauschen, lernen" von Petra Küspert und Prof. Wolfgang Schneider liegt u.a. ein Bericht der Universität des Saarlandes vor. All diese Untersuchungen zeigen, dass eine Überprüfung und eventuelle Förderung dieser Fähigkeiten im Kindergartenalter die Kompetenzen beim Lesen und Rechtschreiben bis weit in die Schulzeit vorhersagen kann.
Kinder mit gering entwickelten phonematischen Fähigkeiten sind meist ohne zusätzliche Förderung nicht in der Lage, sprachlichen Lauten die entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. Lese- und Rechtschreibprobleme, die durch das ungenügende Aneignen einer phonologischen Bewusstheit entstanden sind, können später nur mit erheblichem Aufwand behoben werden.
Durch ein Training der phonologischen Bewusstheit, wie es auch in der Lernpraxis Thomas Wilhelm durchgeführt wird, wird das Kind schon ab dem letzten Vorschuljahr langsam und spielerisch an die Bewusstheit für Wörter, Silben und Laute herangeführt. Es werden Lausch-, Reim-, Silben- und Lautspiele durchgeführt und Freude am Zuhören und dem Umgang mit Sprache vermittelt.
Das Kind wird zudem dabei in seinen Fähigkeiten unterstützt ausdauernd zuzuhören, sich zu konzentrieren und still zu sitzen. Es lernt spielerisch sich auf eine Aufgaben zu konzentrieren und sich nicht von der Umgebung ablenken zu lassen.
Auch bei Kindern, die bereits die Schule besuchen und Lese- bzw. Rechtschreibprobleme haben (siehe die entprechenden Einträge für Legasthenie und LRS), ist dieses Training neben dem Einüben von speziellen Lese- und Rechtschreibstrategien in einer dem Alter angepassten Form häufig ratsam. Die Probleme resultieren in vielen Fällen daraus, dass phonologische Fähigkeiten im Vorschulalter nicht oder nur ungenügend erlernt wurden. Selbst bei Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, kann diese basale Fähigkeit nach einer Überprüfung noch trainiert werden.
Montag, 13. Februar 2012
Frühtest für Dreijährige soll bei Legasthenie helfen
Jedes Jahr kommen in Deutschland mindestens 35.000 Kinder zur Schule, die ein Handycap haben: Lese-Rechtschreibschwäche - Legasthenie. Die Kinder machen immer wieder die gleichen Fehler. Dagegen gibt es Therapien, die müssen nur rechtzeitig eingesetzt werden.
Inzwischen weiß man aus Studien, dass das Gehirn von Kindern mit Lese- und Schreibschwäche Sprache anders verarbeitet. Legastheniker haben es viel schwerer als andere, Gesprochenes in korrekte Schrift zu übertragen und wieder zu lesen.
Bisher tritt das meist erst in der Schule zutage, wenn die Kinder trotz aller Mühe und Zusatzstunden nicht so schnell Lesen und Schreiben lernen, wie ihre Altersgenossen. Ausgrenzung und Schulversagen sind oft die Folge. Dabei sagt eine Lese-Rechtschreibschwäche nichts über die Begabung eines Kindes aus. Es gibt erprobte Therapien, die nur rechtzeitig einsetzen müssen.
Deshalb haben das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie ein gemeinsames Forschungsvorhaben begonnen. Wissenschaftler der beiden Leipziger Institute wollen Kleinkindern ins Hirn „schauen“ und so schon vor der Einschulung künftige Legastheniker finden. Geschehen soll das unter anderem mittels Magnetresonanztomographie (MRT) und Elektroenzephalographie (EEG). Mit frühzeitiger Therapie, so hoffen die Forscher, könnten die Kinder dann schon im Kindergartenalter wichtige Fortschritte machen und später erfolgreicher lernen.
Die sichere Diagnose soll stehen, noch ehe Kinder mit Schrift in Berührung kommen. „Mit unserem Frühtest wären wir in der Lage, bereits im Alter von drei Jahren ein Legasthenie-Risiko festzustellen. Dies wäre ein großer Fortschritt“, sagt der Neuropsychologe Jens Brauer vom Leipziger Max-Planck-Institut.
Frankfurter Rundschau
Mehr unter http://www.fr-online.de/wissenschaft/lese--und-rechtschreibschwaeche-fruehtest-fuer-dreijaehrige-soll-bei-legasthenie-helfen,1472788,11627532.html
Inzwischen weiß man aus Studien, dass das Gehirn von Kindern mit Lese- und Schreibschwäche Sprache anders verarbeitet. Legastheniker haben es viel schwerer als andere, Gesprochenes in korrekte Schrift zu übertragen und wieder zu lesen.
Bisher tritt das meist erst in der Schule zutage, wenn die Kinder trotz aller Mühe und Zusatzstunden nicht so schnell Lesen und Schreiben lernen, wie ihre Altersgenossen. Ausgrenzung und Schulversagen sind oft die Folge. Dabei sagt eine Lese-Rechtschreibschwäche nichts über die Begabung eines Kindes aus. Es gibt erprobte Therapien, die nur rechtzeitig einsetzen müssen.
Deshalb haben das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie ein gemeinsames Forschungsvorhaben begonnen. Wissenschaftler der beiden Leipziger Institute wollen Kleinkindern ins Hirn „schauen“ und so schon vor der Einschulung künftige Legastheniker finden. Geschehen soll das unter anderem mittels Magnetresonanztomographie (MRT) und Elektroenzephalographie (EEG). Mit frühzeitiger Therapie, so hoffen die Forscher, könnten die Kinder dann schon im Kindergartenalter wichtige Fortschritte machen und später erfolgreicher lernen.
Die sichere Diagnose soll stehen, noch ehe Kinder mit Schrift in Berührung kommen. „Mit unserem Frühtest wären wir in der Lage, bereits im Alter von drei Jahren ein Legasthenie-Risiko festzustellen. Dies wäre ein großer Fortschritt“, sagt der Neuropsychologe Jens Brauer vom Leipziger Max-Planck-Institut.
Frankfurter Rundschau
Mehr unter http://www.fr-online.de/wissenschaft/lese--und-rechtschreibschwaeche-fruehtest-fuer-dreijaehrige-soll-bei-legasthenie-helfen,1472788,11627532.html
Mittwoch, 8. Februar 2012
"VOLKS DUDEN"
BILD-Zeitung und Duden-Redaktion bingen den "VOLKS DUDEN" auf den Markt. Leider ist die Rechtschreibung des Titels nicht korrekt :-) Im Begleit-Text ist "Volks-Duden" witzigerweise richtig geschrieben.
Zudem finde ich die Namensgebung - gelinde ausgedrückt - seltsam :(
Link
Zudem finde ich die Namensgebung - gelinde ausgedrückt - seltsam :(
Link
Mittwoch, 1. Februar 2012
Keira Knightley empfiehlt die "Drehbuch-Therapie"
Hamburg - Schon mit sechs Jahren wurde bei Knightley Legasthenie diagnostiziert, doch erst vier Jahre später schaffte sie es, die Leseschwäche zu bekämpfen. 1995 arbeitete die Mutter der Schauspielerin gemeinsam mit Hollywood-Ikone Emma Thompson am Set von "Sinn und Sinnlichkeit".
Den kompletten Text finden Sie auf www.lernpraxis-deutsch.de
Quelle: Der Spiegel, nga
Knightleys Mutter brachte eines der Drehbücher mit nach Hause, um ihrer Tochter zu zeigen, was andere Menschen erreichen können. "Meine Mutter gab mir eine Kopie des Drehbuchs von Emma und sagte: 'Wenn Emma Thompson nicht lesen können würde, würde sie zusehen, dass sie es lernt. Du wirst also anfangen müssen zu lesen, denn das würde Emma auch tun!'", erinnerte sich Knightley im Interview mit der Zeitschrift "GQ".
Quelle: Der Spiegel, nga
Samstag, 28. Januar 2012
Legasthenie zeigt sich schon vor dem Lesenlernen am Gehirn
| Schon bevor sie mit dem Lesenlernen beginnen, haben Kinder mit Legasthenie veränderte Gehirnfunktionen. Zwei Areale, in denen unter anderem gehörte Worte verarbeitet werden, sind weniger aktiv als normal. |
| Das zeige, dass diese Veränderungen nicht erst durch die Probleme beim Lesenlernen entstehen, wie zuvor teilweise angenommen, berichten US-amerikanische Forscherinnen im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences". Stattdessen deute alles daraufhin, dass sich die Unterschiede im Verhalten und in der Verarbeitung von Sprache bei diesen Kindern bereits in den ersten Lebensjahren entwickelten. Möglicherweise seien sie sogar angeboren. Diese Erkenntnis könne dabei helfen, betroffene Kinder früher als bisher zu erkennen und gezielt zu fördern. Unter der auch als Legasthenie bezeichneten Lese-Rechtschreibschwäche leiden rund 5 bis 17 Prozent aller Kinder. Sie haben Schwierigkeiten, gesprochene Wörter korrekt zu erkennen und lernen nur schwer, fehlerfrei zu lesen und schreiben. Oft tritt die Legasthenie in Familien gehäuft auf. Man wisse, dass bei legasthenischen Kindern meist ein neuronales Netzwerk in der hinteren linken Gehirnhälfte gestört sei, sagen die Forscherinnen. Dieses Netzwerk sei entscheidend am Lesen und an verwandten Fähigkeiten wie dem Verstehen von Wörtern beteiligt. „Bisher war aber unklar, ob diese charakteristische Unterfunktion schon vor Beginn des Lesenlernens existiert, oder ob sie erst als Folge der Leseprobleme entsteht“, schreiben Nora Maria Raschle von der Harvard Medical School in Boston und ihre Kolleginnen. Jetzt habe sich gezeigt, dass diese Gehirnveränderungen bei familiär vorbelasteten Kindern bereits mit fünf Jahren, vor Beginn des Lesenlernens, nachweisbar seien. Nach Ansicht der Wissenschaftler liefern die neuen Erkenntnisse erste Ansatzpunkte, wie man die Legasthenie bei Kindern zukünftig früher als bisher diagnostizieren könnte. „Die frühe Identifizierung der Leseschwäche bietet eine Chance, um früh mit Fördermaßnahmen zu beginnen“, sagen die Forscher. Dann ließen sich die Fehlfunktionen im Gehirn vermutlich noch ausgleichen und man könne so den Kindern später schwerwiegende psychologische und soziale Probleme ersparen. Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler die Gehirnaktivität von 36 fünf- bis sechsjährigen Kindern untersucht, die noch nicht mit dem Lesenlernen begonnen hatten. Eine Hälfte der Kinder stammte aus Familien, in denen es bereits mehrere Legastheniker gab, die andere nicht. Alle Kinder schnitten in Tests ihrer Intelligenz und ihrer sprachlichen Fähigkeiten etwa gleich gut ab. Die Wissenschaftler spielten den Kindern jeweils ein Paar ähnlich klingender Wörter vor. Die Kinder sollten anschließend entscheiden, ob beide Wörter mit einem ähnlichen Laut begannen oder nicht. Während des Versuchs maßen die Wissenschaftler die Gehirnaktivität der Kinder mittels funktioneller Resonanztomographie (fMRT). Dieses Verfahren erlaubt es, besonders gut durchblutete und damit auch besonders aktive Gehirnareale sichtbar zu machen. Die Hirnscans lieferten noch eine weitere Erkenntnis: Eine später bei Legasthenikern typischerweise überaktive Region im Vorderhirn reagierte bei allen Kindern noch normal. Das deute daraufhin, dass dieser Gehirnbereich erst beim Lesenlernen damit beginne, die Defizite in den Leseschaltkreisen von Legasthenikern teilweise auszugleichen, vermuten die Wissenschaftler. Quelle: www.facharzt.de, dapd |
Freitag, 27. Januar 2012
Magnetbuchstaben
Abonnieren
Posts (Atom)